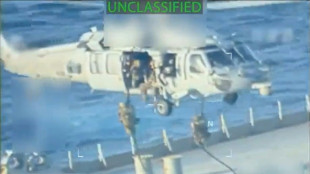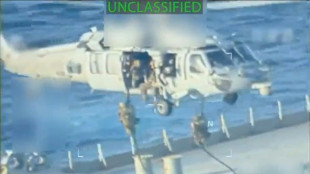Konjunkturprogramm verfehlte vollkommen Klimawirkung

Die von der bisherigen Bundesregierung in der Corona-Krise beschlossenen Konjunkturpakete haben laut einer Studie im Auftrag des Umweltverbands WWF den damit auch angestrebten klimapolitischen Effekt verfehlt. Grund seien strukturelle Defizite wie fehlende Vergabekriterien bei öffentlichen Investitionen oder unpräzise Formulierungen, kritisierte der WWF am Donnerstag in Berlin. Der Umweltverband forderte die sich abzeichnende neue Regierung von SPD, Grünen und FDP zu einem Umsteuern auf.
Die Analyse "Grüner Neustart nach der Pandemie?" von DIW Econ betrachtet demnach zentrale Elemente der deutschen Corona-Hilfspakete und deren Klimawirkung, darunter das Konjunktur- und Zukunftsprogramm (KZP), der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) und die KfW-Sonderprogramme. Darin sei versäumt worden, den Schutz von Klima und Ökosystemen für Vergabeentscheidungen als gesellschaftliches Ziel zu verankern.
"Mit Wumms wollte Olaf Scholz aus der Krise kommen und Angela Merkel versprach bei der Verkündung des Konjunkturprogramms, den Wandel und die Zukunft immer im Blick zu haben", erinnerte der WWF-Finanzexperte Matthias Kopp. Dies sei jedoch nicht erreicht worden.
Für die Zukunft forderte der WWF klare Klima- und Nachhaltigkeitskriterien für die Vergabe öffentlicher Gelder, konkrete Zielsetzungen, ein umfassendes Monitoringsystem, das die tatsächliche Wirkung misst, sowie eine Reaktion auf verfehlte und verpasste Zielsetzungen. "Die konsequente Aufstellung eines Wirkungsverständnisses in alle relevanten Felder von Politikgestaltung muss sich durch den Koalitionsvertrag ziehen", verlangte der Umweltverband.
Dazu gehöre auch die Frage, wie Finanzflüsse aus dem Finanzsystem mobilisiert und gelenkt werden. So umfasse das Konjunktur- und Zukunftsprogramm (KZP) allein Maßnahmen im Volumen von etwa 130 Milliarden Euro. Davon hätten jedoch der Studie zufolge 26 Prozent eine negative Klimawirkung. Diese würden die Maßnahmen mit positiver Klimawirkung, die etwa die gleiche Größenordnung erreichten, wieder komplett aufheben.
Aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro seien bis zum Sommer lediglich neun Prozent der Mittel überhaupt von Unternehmen abgerufen worden. Davon seien nur 0,38 Prozent als eindeutig klimafreundlich einzustufen. Dagegen stünden 93,87 Prozent mit einer negativen Wirkung für das Klima. Grund sei das Fehlen klarer und verbindlicher Anforderungen.
Im Bereich der KfW-Programme flossen der Studie zufolge bis Juni 2021 mehr als 50 Milliarden Euro auf Grundlage von mehr als 130.000 Anträgen. Nur ein Viertel dieser Anträge sei so transparent, dass sie überhaupt in die Analyse hätten einbezogen werden können. Davon zähle mindestens ein Drittel zu emissionsintensiven Sektoren.
"Die nächste Bundesregierung muss bei der Vergabe öffentlicher Gelder zwingend angemessene und zielgerechte klima- und umweltpolitische Kriterien definieren und zugrunde legen", verlangte Kopp. Ein geeigneter Maßstab dafür seien die Umweltziele der EU-Taxonomie, vor allem Klimaschutz und Anpassung an die Klimakrise. Die direkte Unterstützung von Unternehmen durch öffentliche Gelder müsse an das Setzen von Klima- und Nachhaltigkeitszielen und das Formulieren von Umsetzungsplänen geknüpft werden.
(W. Winogradow--BTZ)
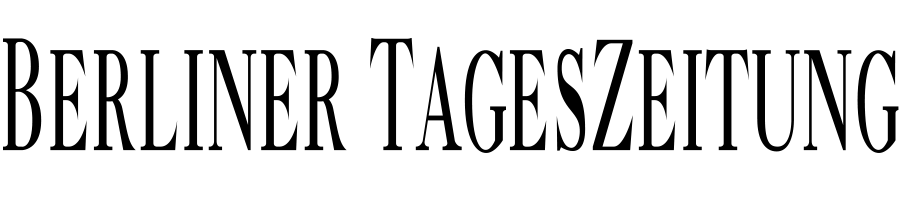
 Berlin
Berlin

 München
München
 Hamburg
Hamburg
 Düsseldorf
Düsseldorf
 Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
 Potsdam
Potsdam
 Leipzig
Leipzig
 Dortmund
Dortmund
 Hannover
Hannover
 Köln
Köln
 Kiel
Kiel
 Bremen
Bremen
 Flensburg
Flensburg
 Rostock
Rostock